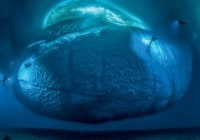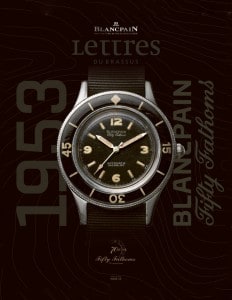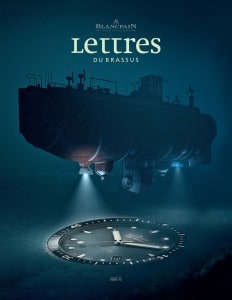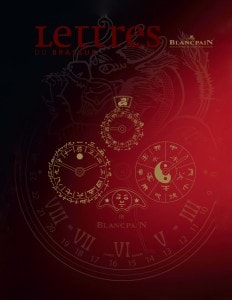In den Ausgaben suchen
Kapitel
Liste der Teile
Kapitel 5
Moderne JAPANISCHE KÜCHE
Neue Kreativität hält eine uralte Tradition lebendig.

Kioto: eine der ältesten Städte Japans und dessen kaiserliche Kapitale während mehr als einem Jahrtausend. Kioto ist aber nicht nur das historische Zentrum der Regierung, sondern auch der Philosophie und der Künste sowie vor allem Geburtsort von Japans raffiniertester und aufwendigster Küche, bekannt als Kaiseki. Ein klassisches Kaiseki-Essen bietet eine Folge gepflegter Speisen – manche mögen sie „karg“ nennen – aus frischen, der Jahreszeit entsprechenden Zutaten, gekocht nach genau vorgegebenen Regeln und bei jedem Gang kunstvoll in mehreren Schalen und Tellern angerichtet. Sie hat ihre Wurzeln im Honzen-ryōri des Kaiserhofs, außerdem im Shojin-ryōri der Zen-BuddhistenKlöster, von denen es in Kioto immer mehr gibt, sowie in der japanischen Teezeremonie. Die KaisekiKüche wird in Kioto mit ihren traditionellen Präsentationen, Ritualen und Zubereitungsarten wie nirgends sonst in Ehren gehalten. Mit diesen Institutionen – der Begriff „Restaurant“ ist zu schwach dafür –, seit Generationen im Besitz von Familien, welche die kostbaren Rezepte hüten wie ihren Augapfel, entstand eine einzigartige Bindung an die Vergangenheit, die für Kioto-Kaiseki charakteristisch ist. Für ihre getreuen Anhänger sind die KaisekiRhythmen bekannt und beruhigend wie ein uraltes Lied. Doch jetzt bläst in Kioto ein frischer Wind, der Veränderungen bringt. Zwei berühmte und hoch dekorierte Mekkas – das in der fünfzehnten Generation geführte Hyotei und das Miyamasou in den Händen der vierten Generation – haben neue Wege beschritten und verjüngen die altüberlieferte Formel mit einem modernen Touch. Ohne Bruch und Revolution haben beide neue und innovative Interpretationen entdeckt, die einerseits ihr Erbe in Ehren halten und es andererseits auf den alten Schienen und Diktaten mit subtilen Kunstgriffen beleben.
Der Begriff „Kaiseki“ setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, kai für „Brust“ und seki für „Stein“, und erinnert an die Mönche, die mit warmen Steinen in den Kleidern ihre Hungergefühle linderten. Später wurde damit ein leichtes Mahl bezeichnet. Die Verbindung zum Tee ergab sich mit der Erfindung der Teezeremonie durch Sen no Rikyu im 16. Jahrhundert. Der starke Matcha-Grüntee, der den Mittelpunkt der Zeremonie bildete, enthielt so viel Koffein, dass er auf leeren Magen getrunken Beschwerden verursachen konnte. Rikyus Antwort darauf war die Einführung von Speisen als Teil des Rituals. Ursprünglich war das Angebot einfach: eine Misosuppe, drei Beilagen und Reis. Mit der Zeit wurden diese Gerichte zahlreicher und raffinierter. Heute gibt es zwei Hauptzweige: Cha-Kaiseki, das sich an der klassischen Teezeremonie orientiert, und Kaiseki im Restaurantstil. Beide Häuser, das Hyotei und das Miyamasou, servieren Kaiseki, wobei im ersteren das Teezeremoniell noch etwas mehr Gewicht hat.

Hinter der Eingangspforte führt der Pfad in die magische Welt des Hyotei.
Hyotei ist das ältere der beiden Restaurants. Sein Äußeres ist bescheiden mit langen, gelben Bambuswänden, einem Schindeldach in japanischem Stil und einem unscheinbaren Eingang. Es liegt im Stadtzentrum unweit des Heian-Schreins (Heian ist der frühere Name von Kioto) und des berühmten Zen-Gartens des Tempels Nanzen-ji. Hat man die Pforte hinter sich, betritt man eine magische Welt, die einen Kontinent weit von der Stadt entfernt scheint, mit einem träge fließenden Bach, in dem Karpfen schwimmen, einem üppig mit Moos bewachsenen Hügel sowie dichten Grünanlagen mit Bäumen, Büschen und Bambus, die an einen Regenwald erinnern, jedoch zu sorgfältig arrangiert und getrimmt sind, als dass man sie als Dschungel bezeichnen könnte. Pfade winden sich durch den Garten und führen zu separaten Bungalows, die als individuelle Speiseräume für Privatanlässe dienen. Eines dieser mit Stroh gedeckten Gästehäuser hat die Feuersbrünste überlebt, die Kioto regelmäßig heimsuchen, und ist mehr als 400 Jahre alt. Alle Bungalows mit ihren Tatami-Matten und der Shoji-Wandverkleidung bieten beschauliche Ausblicke auf den Garten. Um Gästen aus dem Westen etwas mehr Komfort zu bieten, sind einige mit Bodeneinlassungen ausgestattet, was einen davon befreit, im Schneider- oder Fersensitz an den traditionell niederen, lackierten japanischen Serviertischen zu sitzen.
Das Hyotei ist heute in den Händen von Chefkoch Yoshihiro Takahashi, der die Leitung der Küche vor zwei Jahren von seinem Vater übernommen hat. Das will nicht heißen, dass sich Vater Eiichi Takahashi vollständig von der Bühne zurückgezogen hat. Er sucht die Küche immer noch auf, um zu beobachten und jedes von seinem Sohn neu entwickelte Rezept zu testen. Bevor dieser seinen Vater ablöste, machte er zwei ungewöhnliche Abstecher. In Frankreich ist es mehr oder weniger die Regel, dass der Vater seinen Sohn auf die Nachfolge vorbereitet (Beispiele: Marc Haeberlin von der Auberge de l’Ill wurde von seinem Vater Paul ausgebildet, während Vater Pierre in Roanne Michel Troisgros schulte, der nun seinen Sohn César nachzieht). In Kioto hingegen ist das nicht der Fall. Stattdessen funktioniert das Netzwerk, und die künftigen Nachfolger werden für die Ausbildung an ein anderes Restaurant vermittelt. Chefkoch Takahashi absolvierte seine Lehre in der Küche des Tsuruko in Kanazawa, anschließend begab er sich unter die Fittiche von Yoshihiro Murata, Chefkoch des berühmten Kikunoi Ryōtei in Tokio. Interessant an diesem Arrangement ist, dass Murata selbst von Eiichi Takahashi geschult worden war. Dadurch entstanden starke Bande, und Chefkoch Murata besucht denn auch seinen ehemaligen Schüler häufig, um mit ihm Ideen auszutauschen und gemeinsam zu kochen.


Das Hyotei ist der KIOTO-TRADITION treu ergeben, belebt sie jedoch mit Innovationen.
Chefkoch Takahashi ist den Traditionen des KiotoKaiseki treu ergeben, behält jedoch die übrige Welt im Auge. Er gesteht, moderne Küchengeräte zu benutzen, etwa Dampfbacköfen, Schockkühler oder Ausrüstungen fürs Vakuumgaren. Obwohl er diese neuen Methoden als nützlich erachtet, da sie die Zubereitung verbessern, ist er überzeugt, dass es nie einen Ersatz geben wird für das klassische Grillen über einem traditionellen Binchō-tan (manchmal auch „weiße Kohle“ genannt). Seine Innovationen gehen jedoch weit über moderne Geräte hinaus, da er neue Zutaten verwendet, von denen einige bei Dashi verwendet werden, dem harten Kern des Kaiseki. Dashi ist für die japanische Küche, was die Sauce für die französische. Die traditionellste Version ist eine Brühe aus Kombu (einem essbaren Seetang) und Bonito-Flocken (getrocknetem Thunfisch). Die Mengenverhältnisse können variieren, ebenso weitere Zutaten wie Soja, Zucker, Ingwer, Mirin oder Sake. Die Kombu-Basis gehört jedoch zum festen Inventar. Dashi ist nicht nur omnipräsent, es wird auch als ein essentielles Element betrachtet, um dem Gericht Umami zu verleihen. Umami, das mit einem herzhaften Fleischgeschmack verglichen werden kann, wird oft als der fünfte fundamentale Geschmackssinn bezeichnet; die anderen sind salzig, süß, sauer und bitter. Umami ist ein wesentlicher Bestandteil von Kaiseki-Zubereitungen, und Dashi liefert den Schlüssel dazu.
Takahashi hat für sein Dashi neue Konzepte entwickelt. Anstelle des Kombu-Bonito-Rezepts kreierte er ein Tomaten-Dashi. Nicht bloß eine Variante, sondern mehrere, je nach Zubereitungsart (geschmort, gegrillt, roh püriert usw.). Ein Beispiel ist sein neues Tintenfischrezept. Er bereitet zuerst sein TomatenDashi zu, dann blanchiert er den Oktopus dreimal im Sud, damit das Fleisch zwischen den Tauchgängen ruhen kann. Vor dem Servieren gibt er eine Spur Sauerpflaume bei, die dem Gericht zur Aromenexplosion verhilft. Im Winter führt er sein neues Dashi in eine andere Richtung. Statt auf der Sommertomate basiert es auf Wurzelgemüseschalen, die an der Sonne getrocknet wurden.
Die Frage stellt sich von selbst. Das Hyotei erfreut sich einer treuen und begeisterten Kundschaft. Wie führt man diese Neuerungen in einem dermaßen traditionsreichen Haus ein? Chefkoch Takahashis Antwort lautet: „Sehr vorsichtig“. Manchmal serviert er ein Gericht mit zwei Dashi, einem traditionellen und einem neuen, so dass der Gast zwischen dem Gewohnten und der Innovation wählen kann. Ein Beispiel: Ein kürzlich kreiertes Gericht präsentiert zwei Sashimi – eines aus Hamo (einem zarten, ja weichen und nur im Juli erhältlichen Fisch), das andere aus dem festen Fleisch eines Schnappers, geschickt im Ike-Jime-Verfahren aufgeschnitten, das seine Textur bewahrt –, begleitet von einer traditionellen Sojasauce und einer Neukreation mit Tomaten (gegart bei 120 °C), Yuzu (einer Zitronenart) und weißem Soja. Die klassische Sojasauce war selbstverständlich zufriedenstellend, für neue Dimensionen sorgte jedoch die Tomate, sie verlieh beiden Sashimi Glanz und Spannung. Die konventionelle Sojasauce ermöglichte den treuen Gästen, die neue Zutat mit der vertrauten zu vergleichen.

Chefkoch Yoshihiro Takahashi.

Das berühmte Hyotei-Ei mit Feige, Aal und Sushi.
Das HYOTEI-EI: ein essbares Abbild eines idealen Eis.
Takahashi betont, dass er mit dieser Auffrischung und neuen Akzenten das Kioto-Kaiseki nicht auf den Kopf stellen will. Seine Innovationen seien vielmehr ein Weg, um die Kaiseki-Traditionen am Leben zu erhalten. Er will die Essenz und die Werte seiner verehrten Küche beibehalten: die Folge der Gänge mit verschiedenen Kochmethoden (roh, gedämpft, frittiert, gegrillt, geschmort); die unbeirrbare Suche nach hervorragenden saisonalen Produkten; die minimalistische, schnörkellose Strenge, mit der alles, was von den Hauptzutaten des Gerichts ablenkt, verbannt wird; die kunstvolle und poetische Art, mit der die Speisen in speziellen Schalen und Platten serviert werden.
Nirgends war die Treue zur Tradition augenfälliger als bei den Gängen mit Eiern, Sushi, Feigen, Oktopus, Aal und Uni (Seeigel). Wenn es eine Speise gibt, für die das Hyotei besonders berühmt ist, ist es das Ei. Seine Präsentation ist einfach, ja banal, und scheint für einen Tempel der Spitzengastronomie eigentlich unpassend: Es besteht aus einem gekochten, in zwei Hälften geschnittenen Ei. Keine Sauce. Kein Schnickschnack. Keine cleveren Kochtricks. Nur das Ei in seiner ganzen Pracht. Was es besonders macht und seinen Rang sichert, wenn immer das Hyotei erwähnt wird, ist seine Vollkommenheit. Das Gelbe ist knapp stichfest und von köstlicher Konsistenz, das Eiweiß von perfekter Festigkeit, das Äußere glänzend und makellos. Erstaunlicherweise wird es so sauber halbiert, dass keinerlei Schmierspuren zu sehen sind. Das ideale Ei in essbarer Version! Das Sushi vom Red Snapper, Chimaki genannt, kommt im besonderen Stil des im Juli stattfindenden Gion-Fests in Kioto daher. Der Reis und der Fisch wurden in ein Bambusblatt gefüllt, das zu einem schmalen Cornet geformt und mit einem Strohhalm gekonnt verschnürt war. Die Präsentation ist ein Augenschmaus, und es macht Spaß, die Tüte zu öffnen. Die Feige stößt in neue Territorien vor. In der Regel werden Feigen mit einer ReisCracker-Panade frittiert. Das Hyotei veredelt das traditionelle Rezept durch die Verwendung von feinem Sesammehl. Der Oktopus war ungewöhnlich, da anstelle der Tentakel ein Baby-Oktopus mit weißer Misopaste serviert wurde. Beim gegrillten Stück auf dem Tablett handelte es sich um einen um Schwarzwurzeln gewickelten Meeraal mit einem umwerfend rauchigen Umami-Geschmack. Dazu serviert wurde eine Glasschale mit einer Art japanischem Parfait aus Schichten von Paprikaschoten und Tofupüree, gekrönt von einem cremigen Gelee aus Uni und Soja. Der Uni mit seinem Gelee kam als weiches Kissen daher, umhüllt von cremigem Tofu, und bei jedem Bissen sorgte ein im Innern verstecktes knuspriges Pfefferkorn für Überraschung. Ein Meisterwerk.
Die Essenz des KAISEKI ist die kompromisslose Suche nach PERFEKTEN SAISONALEN PRODUKTEN.
Der Hauptgang war ein Seebarsch, japanisch Suzuki genannt. Takahashi verfeinerte ihn selbstverständlich. Der Fisch wurde nicht einfach gegrillt, sondern zuerst mit sehr heißem Öl bestrichen, eine chinesische Technik, die er von seinem Vater übernommen hat. Der Prozess ist kompliziert, da dieses Beizen mehrmals wiederholt werden muss, damit der Fisch dazwischen ruhen kann. Nach Ansicht des Kochs bleibt das Fleisch so saftiger. Akzente kommen von Shiso (ein auch Perilla genanntes japanisches Kraut, geschmacklich zwischen Basilikum und milder Minze), Limone, Essig und Ingwer. Eine brillante Kombination. Die Haut war perfekt knusprig, das Fleisch zart und süß, und die Lime-Mischung rundete das Ganze wunderbar ab.
Bei einem klassischen Kaiseki-Essen darf etwas Gesottenes nicht fehlen, und diesmal bestand das Gericht aus einer Abalonemuschel mit KamoAubergine (eine aus der Region Kamo in der Präfektur Kioto stammende rundförmige Sorte), Tempura und Shishito-Pfefferschoten in einem elegant verfeinerten und traditionell leichten Dashi.
Die Desserts eines Kaiseki-Mahls sollten leicht sein, und unser Sommeressen hielt sich an diese Regel. Köstliche Mango-, Pfirsich- und Melonenschnitze lagen in einem innovativen Ring von ätherischem Kirschgelee. Ein Cha-Kaiseki-Dessert ist jedoch viel mehr als eine Süßspeise, da es von den Ritualen der japanischen Teezeremonie begleitet wird. Eine Frau im Kimono stellte in einer wunderschön lackierten Schale schaumigen Matcha vor den Gast und quirlte ihn nochmals leicht auf, bevor sie sich zurückzog. Nun war der Gast eingeladen, die Schale dreimal leicht zu drehen, um den seitlichen Dekor zu bewundern. Das Tüpfelchen auf dem i war dann das süße Wasser-Konfekt, eine sommerliche Spezialität von Kioto. Zum Schluss erschien die Mutter des Chefs und begrüßte die Gäste persönlich.


Hamo.
Das Ryokan Miyamasou befindet sich anderthalb Autostunden von Kioto entfernt. Die Fahrt führt auf einem einfachen Sträßchen nach Norden, das sich den Berg hinauf windet und streckenweise so schmal ist, dass man nicht kreuzen kann. Hier braucht es keinen Zaun, um das Restaurant von der Außenwelt abzuschirmen. Seine abgeschiedene Lage leistet Gewähr für die Privatsphäre und garantiert, dass die Umgebung bis zum angrenzenden Regenwald nicht überbaut werden kann. Wenn Sie mit Japan die Vorstellung von großstädtischem Gewühl und Menschenmassen verbinden, wird diese von der Abgelegenheit, Ruhe und Isoliertheit des Miyamasou korrigiert. Der dichte Wald und der Bach, der in der Nähe der Speiseräume vorbeifließt, bezaubern derart, dass man nicht in Versuchung kommt, ins Smartphone-Display zu starren.
Das Restaurant Miyamasou wird von Chefkoch Hisato Nakahigashi und seiner Frau geleitet und ist seit hundertzehn Jahren im Besitz seiner Familie. Obwohl er viel von der Kochphilosophie seines Vaters übernommen hat, der die japanische Konvention pflegte, hat er sich in der Welt umgeschaut. Bevor er in einer anderen japanischen Küche arbeitete, reiste er nach Frankreich. Statt im Hintergrund am Herd zu wirken, war er lieber als Kellner tätig. Nakahigashi wollte lernen, wie Gäste auf ihr Essen und das Restauranterlebnis reagieren. Das brachte ihn nach Paris und schließlich ins Bordelais nach Eugénie-les-Bains zum Dreisternekoch Michel Guérard. Erst nach der Rückkehr in die Heimat absolvierte er eine Ausbildung in einer japanischen Küche, und zwar im Kaiseki Tsuruko in Kanazawa in der Präfektur Ishikawa. Nach dem Ableben seines Vaters kehrte er ins Miyamasou zurück.
Ein Kennzeichen der Kaiseki-Küche ist die kompromisslose Verwendung bester lokaler Zutaten. Was heißt jedoch „lokal“? Im Miyamasou wird dieser Begriff extrem streng interpretiert. Für Chefkoch Nakahigashi bedeutet „lokal“, dass die Zutaten in der wilden Umgebung des Ryokan beschafft werden. So stammen zum Beispiel alle Fische, die auf den Teller kommen, aus den kühlen Gewässern der Berge, da das Meer, obwohl nicht besonders weit von Kioto entfernt, nicht wirklich „lokal“ ist. Das gilt auch fürs Gemüse, das aus benachbarten Parzellen stammt. Aber auch hier ist er außerordentlich wählerisch. Er besteht nicht nur auf Gemüse, das in der Umgebung gewachsen ist, er zieht zudem Wildpflanzen den kultivierten vor. Der einzige Eingriff in seinen Naturgärten sind Zäune zum Schutz der Pflanzen vor Wildtieren. Abgesehen davon will er sie unbeeinflusst und wild gedeihen lassen. Und welchen Unterschied stellt


Chefkoch Hisato Nakahigashi.
VEGETABILIEN sind die STARS im Miyamasou.
er zu den kultivierten Feldfrüchten fest? Er glaubt, dass bei Pflanzen, die mit anderen konkurrieren, einzigartige Dimensionen zum Ausdruck kommen. Nakahigashi genügt das natürliche Wachstum nicht, er studiert die Wachstumszyklen, wie die Pflanzen leben und wann sie blühen, damit er besser versteht, wie er sie in seine Küche integrieren kann. Lokale Beilagen und Fleisch – Bär, Hirsch, Wildschwein – aus einheimischer Jagd in den umliegenden Bergen sind denn auch die Markenzeichen während der Wildsaison.
Die Leidenschaft, mit der er sich dem Sammeln in seinen „Gärten“ widmet, macht Gemüse zum Star der Zutaten in Nakahigashis Küche. Ein Paradebeispiel ist die Zubereitung des Wagyu-Rinds. Normalerweise beginnen Köche bei der Konzeption eines Rindfleischgerichts mit dem Fleisch, bevor sie sich um die Beilagen und deren Zubereitungsart kümmern. Nakahigashi hingegen startete seine Kreation mit einem Blatt. Genauer gesagt, mit einem Kuzublatt von einem Baum, der auf dem Grundstück des Restaurants steht. Er suchte nach einer Möglichkeit, etwas in Kuzu Eingewickeltes zu garen, damit dieses seinen Duft überträgt. Deshalb ist das vermeintliche Rindfleischgericht eigentlich ein Blattgericht. Es dauerte drei Jahre, bis die Zubereitung perfekt war. Das saftig-fette Wagyu wird drei Tage in einer Mischung von Miso, Mirin und Soja mariniert. Dann wird es mit Sansho-Blüten gewürzt (Sansho ist ein japanischer Bergpfeffer), ins Blatt gewickelt und langsam bei einer Temperatur von nur 43 °C gegart. Das Resultat ist triumphal. Das Fett des Wagyu nimmt die Marinade auf, wodurch das Innere in Textur und Geschmack einer Foie gras gleicht, mit Noten des Kuzublatts und des Pfeffers als Kontrapunkt.

Wagyu-Rind im Kuzublatt.

Hassun-Gang.

Auf Eis serviertes Karpfen-Sashimi.
Im Miyamasou serviert man WILDPFLANZEN aus den eigenen Gärten.
Bei einem Kaiseki-Mahl ist es Tradition, als zweiten Gang ein Hassun aus saisonalen Produkten aufzutragen. Die Interpretation im Miyamasou war ein Potpourri von Zutaten aus den Bergen, die in einem Körbchen arrangiert wurden: Gurken, Shiitake und Kräuter an Tofusauce, Teriyaki-Babybambus, frittierte Konnyaku (eine auch „Teufelszunge“ genannte Pflanze) in knuspriger Reispanade, eine Krabbe mit Edamame (jungen Sojabohnen) und ein mariniertes Eigelb. Alles war hervorragend. Die Gurke blieb ungeachtet der cremigen Tofusauce knackig. Der Bambus war erstaunlich delikat und weich. Der Höhepunkt war jedoch eindeutig das Eigelb. Nakahigashi legt es während drei Tagen in Miso ein, wodurch es die Konsistenz und das glänzend rote Aussehen eines kleinen Goudakäses erhält.
Die Präzision und Detailversessenheit, welche die japanische Küche allgemein und insbesondere das Kaiseki kennzeichnen, hatten beim Sashimi aus Flusskarpfen einen großen Auftritt. Karpfen ist bekannt für seine feste, oft gummiartige Konsistenz, da sein Fleisch nicht den geringsten Irrtum hinsichtlich Gartemperatur und Tranchieren toleriert. Der Fisch wurde am Tisch gekonnt zertrennt und jede Scheibe auf Eis gelegt, bevor sie in einem ebenfalls mit Eis gefüllten Holzkästchen arrangiert wurden. Dazu gab es mild gewürztes Flussmoos, eine essbare Blume und frisch geriebenen Wasabi.
Auf den Fisch folgte im Miyamasou selbstverständlich ein vegetabiler Gang, der farblich kontrastreich aus gelben Tomaten, rotem Paprika und wildem Bergspargel bestand, das Ganze von einer köstlichen YuzuMiso-Glasur akzentuiert. Jedes Element stand auf seinem jahreszeitlichen Höhepunkt.
Für eine kurze Periode im Sommer ist es Zeit für den Ayu, einen kleinen einheimischen Flussfisch. Das Miyamasou hält die Tradition aufrecht, den Fisch über Binchō-tan-Kohle zu braten. Klassisch ist auch die Grillmethode, jeden Fisch längs aufzuspießen, damit er sich durch die Hitze nicht krümmt, sondern gleichmäßig gegart wird. Der Ayu wird ganz verspeist, vom Kopf bis und mit Schwanz, wobei die verschiedenen Körperteile unterschiedlich schmecken, angefangen mit den Bitternoten des Kopfs bis zur Süße des Schwanzes. Dazu wird eine Essig-Kräuter-Sauce serviert.
Dank der Vorliebe des Miyamasou-Küchenchefs für Gemüse gibt es einen zweiten überwiegend vegetabilen Gang. Diesmal stehen die japanische Aubergine und die Gurke im Mittelpunkt. Die Eierfrucht wurde langsam im Ofen gegart, bis ihre gebratene Haut dem Fleisch Rauchnoten verlieh. Da die Aubergine wie die Gurke geschmacklich mild sind, verschaffte Nakahigashi dem Gericht mit einem klassischen, geleeartigen Kombu-Bonito-Dashi und Kinome (einem pfefferigen Kraut) zusätzlichen Pep.
Pickles gehören zum Inventar jeder Kaiseki-Ballade, und Restaurants von der Klasse des Miyamasou salzen selbstverständlich etwas Besonderes ein. Chefkoch Nakahigashi besitzt einen speziellen Keller für seine gepökelten, lange marinierten und fermentierten Produkte. Sie haben in seiner Küche einen derart hohen Stellenwert, dass er plant, nächstes Jahr einen wesentlich größeren Keller zu bauen. Die Pickles sind von einer Frische und Köstlichkeit, wie sie auf den Märkten nicht zu finden sind. Sie werden mit Sauerpflaumen zu Reis serviert, der von einem süßlich eingelegten Fisch gekrönt wird.
Selbstredend war der Berg die Quelle des Desserts. Den Mittelpunkt bildete eine wilde Pflaume, die in Wein gesimmert, mit Pinienkernenmilch serviert und von einem raffinierten, diskreten Minzgelee abgerundet wurde. Die Balance war perfekt, da die Pinienkernenmilch die Säure der Pflaume angenehm abrundete.


Ayu-Fische werden über Bincho-tan-Kohle gegrillt.
Ist von der Weiterentwicklung der traditionellen Küche Japans die Rede, darf in Tokio das Sushi nicht vergessen werden. Kioto ist für seine Treue zu den Wurzeln seiner Kochkunst und entsprechende Verweise bekannt; in Tokio gibt es solche Einschränkungen nicht. Es ist eine pulsierende Großstadt, die keine Grenzen kennt. Die folgende Zahl gibt einen Eindruck von ihrer Vielfalt: Tokio beherbergt rund 300 000 Restaurants, während New York gerade mal 30 000 zählt. Man findet in Tokio mühelos alles, was das Herz begehrt. Innovatives. Noch nie Dagewesenes. Gutes und Schlechtes. Groteskes. Wirklich einfach alles. Allein im Stadtviertel Ginza gibt es 300 Sushi-Lokale!
Sushi selbst ist jedoch anders. Hier gibt es Regeln, sogar in Tokio. In deren Rahmen findet man dennoch Innovationen und Modernität. Das Sushi Tokami in der Ginza liefert den Beweis dafür.
Wie viele der besten Sushi-Restaurants in Tokio ist das Sushi Tokami winzig. Sein Tresen bietet nicht mehr als zehn Gästen Platz. Tresenbestuhlung ist auf diesem Niveau die Norm, und die Herstellung der Sushi findet vor den Augen der Gäste statt. Eine persönliche Bedienung durch den Chefkoch wird hier erwartet.
Hiroyuki Sato ist der Besitzer und Chefkoch des Sushi Tokami. Der Berufsweg eines Sushi-Chefkochs ist nie kurz, und Satos Karriere macht hier keine Ausnahme. Er begann als Kellner zu arbeiten, realisierte aber, dass in Japan längerfristige Anstellungen und Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Beruf begrenzt sind. Da sein Vater jedoch einen Sushi-Shop besaß, hatte Sato schon eine Ahnung von diesem Metier. Seine offizielle Ausbildung begann er bei einer Reihe unterschiedlicher Sushi-Restaurants, am längsten blieb er im Akizuki, einem berühmten Sushi-Lokal in Shibuya, Tokio. Sogar nach mehreren Lehrjahren war es ihm noch nicht erlaubt, Gäste zu bedienen. Diese Rolle blieb dem Chefkoch vorbehalten. Immerhin durfte Sato mit der Zeit dem Meisterkoch des Akizuki nach der Schließung des Lokals aus den übriggebliebenen Resten Sushi zubereiten und servieren. Dank den Kritiken und Tipps des Chefs perfektionierte Sato seine Technik.

Chefkoch Hiroyuki Sato.
Laut Sato meinen manche, jeder könne Sushi machen. Doch seiner Ansicht nach liegt das Geheimnis des besten Sushi in den geübten Händen des Chefkochs. Anfänger konzentrieren sich auf den Fisch, wobei die Auslese und das Tranchieren selbstverständlich wichtig sind. Für Meister hingegen ist es die Liebe zum Reis und seiner Zubereitung, die Sushi-Kunst entstehen lässt. Reis ist jeden Tag anders, da er je nach Alter, Feuchtigkeit und Temperatur unterschiedlich reagiert. Kurz nach der Ernte enthält Reis eine Menge Wasser. Mit der Zeit wird er trockener. Laut Chefkoch Sato ist er im allgemeinen nach einem Jahr am besten. Es gibt jedoch keine feste Zeit und kein Rezept. Er prüft ihn jeden Tag. Seine bevorzugte Sorte ist ein spezieller Hybrid-Reis, der aus der Präfektur Yamagata im Norden Japans stammt. Der Lieferant ist wichtig, nicht bloß zur Gewährleistung der Qualität, sondern auch wegen der Präzision des Polierens. Das Polieren muss sorgfältig erfolgen, um den Bruch der Körner zu vermeiden.
Jeden Morgen besucht Sato den Tsukiji-Fischmarkt im Zentrum von Tokio. Er hat Beziehungen zu Lieferanten geknüpft, einen für Thunfisch, einen für Seeigel und einen für Schellfisch. Jeder der drei stellt für ihn eine spezielle Box bereit. Davon trifft er seine eigene Auswahl im Hinblick darauf, welche Exemplare am besten zu seinem Reisstil passen. Dazu kommt die Frage des Alters. Viele glauben, dass jeder Sushi-Fisch nach dem Fang so schnell wie möglich konsumiert werden muss. Das stimmt nicht in jedem Fall. Einige Thunfischteile können bis zu einer Woche lagern und werden vom Meister häufig kontrolliert, um zu entscheiden, wann der ideale Zeitpunkt gekommen ist. Auch Kombu-Meeresalgen erfordern besondere Aufmerksamkeit, und Chefkoch Sato hat für ihre Zubereitung seine eigene Philosophie. Er lässt Kombu fünf Jahre lagern. Das verleiht ihm einen besonders reichen Umami-Geschmack.
In der Sushi-Welt Tokios wird dem Reis üblicherweise weißer Essig beigefügt. Im Sushi Tokami verwendet man roten Essig aus Sake-Hefe, und der Fisch wird mit Blick auf seinen extrareichen Umami ausgewählt, der durch die außergewöhnliche Kombination noch gewinnt. Abgesehen vom Geschmack, der eher leicht säuerlich und rein als süß ist, wird der Reis dank dem roten Essig bernsteinfarben.
In einfachen Sushi-Restaurants wendet man sich meist zuerst den Nigiri-Sushi zu. Nigiri ist die klassische Sushi-Präsentation, bei der eine handgeformte Kugel oder Rolle Reis (Shari) mit einer Scheibe Fisch (Neta) belegt wird. Nigiri gibt es seit ungefähr zweihundert Jahren, nicht als großes Esserlebnis, sondern als einfaches Stück Fisch des Tagesfangs auf Reis, das von den Straßenhändlern Tokios Passanten als günstiges Fast Food verkauft wurde und wird.
In einem renommierten Lokal wie dem Sushi Tokami beginnt das Mahl vor dem Einstieg in die Nigiri mit einer reichhaltigen Auswahl an Vorspeisen. Der Servierstil des Sushi Tokami ist Omakase. Das bedeutet, dass der Koch entscheidet, was für ein Menü er dem Gast serviert. Der erste Starter bestand bei uns aus einem ätherisch zarten Stück Tosaki (rotes Thunfischfleisch vom Nackenstück), um das er ein hauchdünnes Blatt Nori (Meeresalge) gewickelt hatte. Optisch konnte man es mit einer grünen Frühlingsrolle vergleichen. Der extrem seltene Tosaki war außerordentlich aromatisch und saftig. Im Unterschied zum Nori einfacherer Sushi-Restaurants knusperte sein Blatt angenehm unter den Zähnen und war so fein und leicht, dass es nicht vom Thunfisch ablenkte.

Tosaki.

Im Sushi Tokami wird der Reis mit rotem Essig gewürzt.
Anfänger konzentrieren sich auf den Fisch; für die SUSHI-MEISTER beruht im REIS die hohe Kunst.
Als nächstes folgten Junsai (gallertartige Sprossen, die frisch nur kurze Zeit im Sommer erhältlich sind), Uni und gedämpfter Awabi (Abalone). Bei dieser Kombination kamen drei Formen von subtiler Zartheit zum Ausdruck, die jede anders interpretiert wurde. Daneben lagen zwei Häppchen von sanft geröstetem Anago (Meeraal), der eine mit Wasabi, der andere mit Sauerpflaume getoppt. Beide Garnituren lieferten einen Kontrapunkt zur Üppigkeit des Aals.
Dann gab’s drei sehr kleine, knusprig frittierte Ayu mit einem sauren Essiggelee. Die Kombination der „rustikalen“ Konsistenz mit dem delikaten Fischgeschmack löste wahre Wogen an Geschmacksempfindungen aus.
Ein Hochgenuss war die Foie gras vom Seeteufel mit Palmkohl, frischen Pilzen und Mikrotomaten. Die Zubereitung erinnerte in Reichhaltigkeit, Geschmack und Beschaffenheit an französische Entenstopfleber.
Die letzte Vorspeise war eine Art Barrakuda, mariniert in Nukazuke (ein japanisches Säuremittel aus fermentierter Reiskleie, die üblicherweise zum Einlegen von Eierfrüchten verwendet wird). Als Garnitur dienten zwei Streifen der Kioto-Paprikaschote. Das Gericht strömte Umami-Wellen an Tiefe und Kraft aus.
Schließlich wandte sich das Mahl einer Parade von Nigiri-Sushi zu. Die Vielfalt war atemberaubend. Selbstverständlich gab es drei Arten von ThunfischMaguro: rot (in Sojasauce mariniert), mittelfett (Chūtoro) und fett (Ōtoro). Alle drei waren vom selben Fisch geschnitten. Meister Sato bevorzugt kleinere Thunfische (zwischen 30 und 70 Kilo Gewicht). Welchen Unterschied stellt er im Vergleich zu größeren Exemplaren fest? Ihre Ernährung! Kleinere Fische jagen im seichteren Wasser in Küstennähe vor allem Jungfischchen aller Art, die sich vor Flussmündungen von Plankton ernähren. Alle drei Nigiri zeugten von seiner Vorliebe für gut gelagerten, alten Essig, der die Reichhaltigkeit des Thunfischs glänzend ergänzte.
Bei zwei weiteren Zubereitungen kam sein gealterter Kombu zum Einsatz: beim Kohada (Weißfisch), den er in Essig und Sake marinierte, und bei einem wunderbaren Japanischen Stint (Sillaginidae), dessen Süße durch den Kombu-Umami noch verstärkt wurde.
Bemerkenswert war die bei Niedertemperatur gegarte Hamaguri (japanische Venusmuschel), die so ihre Süße und natürliche gummige Konsistenz behielt. Dazu wurde ein klassisches gezuckertes Dashi serviert.


Varianten von Nigiri-Sushi, im Uhrzeigersinn von links oben: Otoro, Uni, roter Thunfisch und Aal.
Alle drei vorgestellten Restaurants wurden mit MICHELIN-STERNEN ausgezeichnet.
An diesem Abend standen zwei Yin-Yang-Gerichte auf dem Menü. Das erste war eine äußerst innovative Zubereitung des Seeigels. Chefkoch Sato kombinierte den Uni in zweierlei Temperaturen, warm und kalt. Die Empfindungen auf der Zunge waren faszinierend, da wir zuerst die aufregende kalte Version in Angriff nahmen und dann das beruhigende warme Sushi genossen. Glänzend. Das nächste war ein Nodo Guro (ein Seebarsch), der zuerst in Kombu mariniert und anschließend kurz auf der Hautseite gegrillt wurde. Wiederum war der Kontrast spannend: Die Haut war schön knusprig, das Fleisch von so himmlisch zarter Textur, dass es im Mund schier verdunstete.
Zwei Versionen von Unagi (Aal) kamen Seite an Seite auf den Tresen, die eine in einer Soja-ZuckerMirin-Sauce gedämpft und mit Dashi serviert, die andere mit Salz und Yuzu gewürzt und gegrillt. Der gedämpfte, warm gereichte Fisch erinnerte an ein weiches Kissen, während die Grillversion fester im Biss war.
Natürlich gab es auch eine Misosuppe. Chef Sato hatte die Brühe nach französischem Vorbild mit Knochen und Fischstücken gekocht.
Der klassische Abschluss eines Sushi-Essens ist ein süßes Omelett nach japanischer Art. Auch hier waren französische Akzente erkennbar. Die Oberfläche der glänzenden gelben Kruste war karamellisiert wie bei einer Crème brûlée. Eine innovative große Küche sollte nie einem Rundgang in einem verstaubten Museum gleichen. Lebendigkeit und Dynamik gepaart mit Respekt vor der Tradition ist eine erfolgreiche Formel, die auch den altehrwürdigen klassischen Kaiseki- und Sushi-Küchen frischen Wind in die Segel bläst.1
1 Jedes der drei Restaurants wurde vom Guide Michelin mit Sternen belohnt: das Hyotei mit drei, das Miyamasou mit zwei und das Sushi Tokami mit einem.

Misosuppe.
Andere Ausgaben
Verpassen Sie nicht die neueste Ausgabe
Registrieren Sie sich und erhalten Sie neue Veröffentlichungen