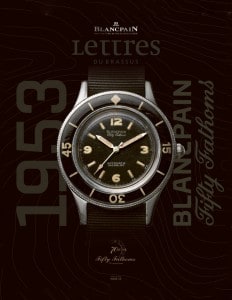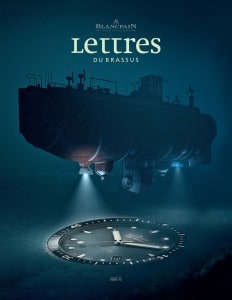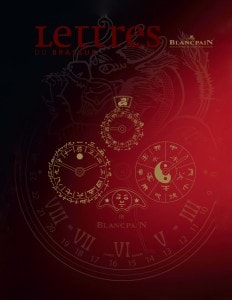In den Ausgaben suchen
Kapitel
Liste der Teile
Kapitel 4
Expedition GOMBESSA
Der Quastenflosser, ein Zeuge ferner Ursprünge.

In der Tiefe des Meeres fühlt man sich allein, obwohl DIESE EINSAMKEIT NUR DANK DER UNTERSTÜTZUNG DER ANDEREN möglich ist.
Die Geschichte beginnt am Vortag. Wir haben den Tauchgang bereits hinter uns, das Meer auch. Die Piste windet sich durch eine riesige, dicht bewaldete Düne. Unser Pick-up hinterlässt eine gewaltige Staubwolke. Wir selbst sitzen noch im Schlauchboot auf dem Anhänger … zwischen dem Geländewagen und der Staubwolke. Das Material überquillt: 14 Gasflaschen und 400 Kilogramm Ausrüstung für nur vier Taucher.
Nach vierzig Minuten, bei der Ankunft im 15 Kilometer vom Meer entfernten Basislager, ist es halb vier Uhr nachmittags. Unser kostbares Hightech-Tauchmaterial ist unter Eukalyptusbäumen verstaut, in einer Garage am Ende der Welt, wo jede Maschine des 20. Jahrhunderts repariert werden kann. Hier, mitten im Busch, ist es ein Luxus, autonom zu sein.
In diesem Camp pflegen wir jeden Abend und Morgen unsere wertvollen Rebreather-Kreislauftauchgeräte. Leeren und Ersetzen des Atemkalks, der beim Tauchen das Kohlendioxid im Atemgas bindet; Demontieren der sechs Flaschen mit komprimiertem Gasgemisch, die alle mit der Tauchmaske verbunden sind. Das Gas jeder Flasche ist nämlich nur für bestimmte Tiefen geeignet. Deshalb müssen deren „Cocktails“ jeden Tag sehr exakt neu gemischt werden … ein Fehler hat hier bestenfalls einen enormen Tiefenrausch zur Folge, im schlimmsten Fall Epilepsieanfälle und einen Kreislaufkollaps.
Das alles beschäft igt uns bis zum Abendessen, das uns einen kurzen Moment der Entspannung verschafft . In der übrigen Zeit erfüllt jeder seine Aufgabe im Team. Ein Team, das vital ist, denn das Paradoxe am Tieftauchen ist ja, dass man sich da unten allein fühlt, obwohl diese Einsamkeit nur dank der Unterstützung der anderen möglich ist. Die anderen, das sind JeanMarc und Eric, beide rund fünfzehn Jahre älter als ich, mit großer Erfahrung im Umgang mit der Dekompression. Sie planen für mich die Tauchgänge und sorgen so dafür, dass meine Obsession nie Oberhand über die Vernunft gewinnt. Sie sind die Meister des Maßhaltens. Cédric wiederum findet als großartiger Logistiker stets Lösungen, damit unser Abenteuer gut verläuft … wobei Abenteuer ein Euphemismus für Knochenarbeit ist. Außerdem transportiert er beim Tauchen ein oder zwei Fotokisten für mich. Ebenso wie Tybo und Florian, beide erfahrene technische Taucher, gleichermaßen ruhig und enthusiastisch (eine seltene Mischung), die als Allrounder auch Träger und Beleuchter sind und nötigenfalls die wissenschaftlichen Kameras bedienen … stets mit der unveränderlichen Lust, herauszufinden, was da unten


Nach ZWANZIG MINUTEN Fahrt erreichen wir unser Ziel etwa DREI SEEMEILEN vor der Küste, sind jedoch noch weit davon entfernt, ins Wasser zu steigen.
geschieht. Schließlich bleibt noch Yanick, der Unermüdliche und immer Gleichgelaunte. Er ist der Kamera- Chefoperator, der in 120 Meter Tiefe die weltweit erste Begegnung eines Menschen mit einem Coelacanthus filmen muss. Seine Gelassenheit angesichts einer solchen Herausforderung ruft bei mir Bewunderung hervor oder macht mich komplett wahnsinnig, je nachdem.
Nach dem Abendessen muss ich noch an meinen Kisten mit den Fotoapparaten arbeiten, die unter dem zu starken Druck enorm leiden. Es gilt alles gut einzufetten, die Dichtungsringe zu kontrollieren und anderes mehr. Die schlaflose Nacht werde ich nie vergessen, als das Schauglas einer Fotokiste in 111 Meter Tiefe bei einem Aufprall zerborsten war. Das schlug schon auf den Magen: eine völlig kaputte Nikon D3s, die damals beste Kamera für meine Zwecke dank dem Bildsensor mit bis zu 100 000 ISO – unersetzlich, wenn ich das schwache, aber so ganz besondere Dämmerlicht in mehr als 100 Meter Tiefe verewigen will.
Wir gehen früh schlafen, zwischen 21 und 22 Uhr. Die Tage sind dermaßen intensiv, dass nur die Nächte Gelegenheit zum Abschalten bieten und zu realisieren, dass ich dabei bin, mir meinen Traum zu erfüllen. Ein Luxus! Meine Tage bestehen aus lauter Entscheidungen und Aktionen, die einmal geplant und ein andermal improvisiert sind …
5.30 Uhr: Tagwache. Anschließend dreißig Minuten Gymnastik, um den Rücken wieder in Form zu bringen. 6.15 Uhr: Nach kurzem Frühstück zurück zu unseren Tauchgeräten, Montage der entscheidenden Teile und Funktionscheck: Ist der geschlossene Atemkreislauf dicht? Sind die Akkus aufgeladen? Die Sauerstoff - Analysatoren und die DekompressionsParameter richtig eingestellt? Die Schlauchaufroller und Aufstiegbojen in Ordnung? … 7.30 Uhr: Beladen des Pick-ups und Abfahrt mit unserem 7 Meter langen Festrumpfschlauchboot auf dem Anhänger. 8 Uhr: Ankunft an einem schier endlosen Strand, der andauernd von den rötlichen Fluten in der Trichtermündung eines Flusses und vom schweren Traktor modelliert wird, der den Pick-up im weichen Sand ablöst.



Fürs Nachdenken bleibt keine Zeit, die Befürchtungen sind vorbei, JETZT MUSS ICH HANDELN!
Aufbruch. An Bord des Bootes muss alles gründlich festgemacht werden. Die Passage der Brandungswellen ist ein kritischer Moment; jedes Jahr kehren an genau dieser Stelle mehrere Boote wieder um. Nach zwanzig Minuten Fahrt erreichen wir unser Ziel etwa drei Seemeilen vor der Küste, sind jedoch noch weit davon entfernt, ins Wasser zu steigen: GPS und UltraschallEcholot sind eingeschaltet, die Unterwassergebiete müssen lokalisiert werden. Ich sitze im Bug, zusammen mit Peter Tim, der einzigen Person, die uns genau dahin führen kann, wo es vermutlich Quastenflosser gibt. Anno 2000 hatte er als erster bei einem Tieftauchgang in diesen Meerescanyon in einer Höhle einen Coelacanthus entdeckt. Es war nicht einfach gewesen, Peter von der Seriosität unseres Vorhabens zu überzeugen, damit er bereit war, uns dorthin zu begleiten, wo er vor zehn Jahren zwei Taucher mit dem gleichen Wunsch hingeführt hatte … zwei Taucher, die an jenem Tag starben.
Heute ist die Strömung ziemlich stark, so dass man 150 Meter vom Zielgebiet entfernt abtauchen muss, um es in der Tiefe zu erreichen. Meine drei Kollegen und ich beladen uns jeder mit ungefähr 70 Kilogramm Ausrüstungsmaterial. Das ist im Boot recht mühselig, doch zum Glück schwindet das Gewicht im Wasser.
Letzte Überprüfung der elektronischen Anzeigen, alle sind bereit, das Schiff ist auf dem Abtauchpunkt positioniert. Seit dem Aufwachen hindert mich ein Klotz im Magen am Lachen, es ist ein wenig wie die Angst, etwas vergessen zu haben. Ich muss an alles denken, bevor ich handeln kann und keine Zeit fürs Nachdenken bleibt. Um so befreiender wirkt der Augenblick, als ich mich im Heck des Schlauchboots ins Wasser kippen lasse. Jetzt heißt es handeln!
Der Druckanstieg beim Abtauchen, so steil und schnell wie möglich, ist heft ig. Zum Glück funktioniert der Druckausgleich meiner Ohrtrompete, der famosen eustachischen Röhre, von selbst, ohne dass ich die Übungen für die BTV (béance tubaire volontaire) absolvieren müsste. So kann ich noch schneller abtauchen. In weniger als einer Minute bin ich in 50 Meter Tiefe. Hier verlangsame ich den Abstieg, schaue mich nach meinen Begleitern um, konsultiere den Kompass, um den Kurs zu verfeinern. 60, 70 Meter: Ich halte die Richtung und Geschwindigkeit. 80 Meter: Langsam beginne ich den Rand des Canyons zu erkennen. 90 Meter: Ich sehe deutlich den Kontrast zwischen der senkrechten Wand, dem dunklen Graben auf der einen und dem weißen Sand auf der anderen Seite! Der sowohl anstrengende als auch befreiende Abstieg ist gut verlaufen. Diese heikle Phase beschäft igt mich seit dem Aufwachen: Verpass die Landung nicht! Geht da etwas schief, muss die ganze Erforschung abgebrochen werden. Ein neuer Tauchversuch am selben Tag ist unmöglich …
100 Meter: Ich erreiche die Grabenkante, besiedelt von Peitschen- und Schwarzen Korallen, Tannenzapfenfischen, Messerlippfischen und einem Blauen
Mit ein paar Flossenschlägen habe ich EINE ANDERE WELT erreicht.
Seifenbarsch, lauter lebende Anzeichen, dass ich die 100-Meter-Linie überschritten habe und in die biologische Welt der aphotischen Zone eintauche. Das ist der Tiefenbereich des Meeres, in den weniger als ein Prozent des Sonnenlichts vordringt, weshalb die Photosynthese und damit pflanzliches Leben unmöglich sind. Ein anderer Planet.
Dabei trennen uns nur 100 Meter von diesem anderen Planeten. Eine 100 Meter hohe Wassersäule, eigentlich nichts und doch unglaublich trennend. Vom Weltraum aus gesehen ein dünnes Band, eine Schwelle, die man mit ein paar Flossenschlägen passiert. Doch ich passiere ein räumlich-zeitliches Tor, das sich in jedem guten Science-Fiction-Roman öffnen könnte: mein ganz persönliches „Stargate“. Ein außergewöhnlicher Wechsel, der mich in wenigen Minuten zu einem Tier bringen soll, das gewissermaßen seit 65 Millionen Jahren keinen Besuch mehr erhalten hat. ScienceFiction pur.
120 Meter: Vor uns die Felswand mit ihrer Reihe horizontaler Höhlen. Die Suche beginnt, und die Uhr läuft . Hier zählt sich die Zeit in Minuten, obwohl ich mir hier eine Ewigkeit an Erinnerungen schaffe. Jede Höhle, jeder Unterschlupf wird von unseren Lampen ausgeleuchtet. Wir haben Glück, schon bei der zweiten Höhle sehe ich ihn, den imposanten Coelacanthus. Am Eingang „steht“ er ruhig auf seinen an rudimentäre Füße erinnernden Quastenflossen, denen er seinen deutschen Namen verdankt. Unser Abstieg hat weniger als drei Minuten gedauert. Ist dieser Planet wirklich nur drei Minuten von unserer Welt entfernt? Die Zeit hat hier nicht denselben Wert wie oben. Der Beweis? Der Abstieg dauert drei Minuten, der Rückweg fünf Stunden!
Behutsam nähere ich mich ihm, diesem lebenden Fossil. Je näher ich komme, desto stärker ist meine Emotion. Ich muss sie beherrschen und mich konzentrieren. Genau beobachten, exakt abbilden; noch nie war ein Naturfotograf so nah an ihm dran. Ich halte einen gewissen Abstand, um ihn nicht zu verscheuchen. Wie reagiert ein Quastenflosser auf einen Taucher? Niemand weiß das genau. Nach so vielen Vorbereitungen die lebende Legende zu erschrecken wäre wirklich die Höhe! Würde sich der Fisch aus dem Staub machen, stellte dies die von mir seit langem verteidigte Überzeugung in Frage, dass der Mensch überall, wo er physisch präsent sein kann, bessere Resultate erbringt als ein Roboter.
Das erste Gefühl: Er hat uns gesehen, wendet seinen Kopf mir zu, zieht sich aber nicht in die Tiefe seiner Höhle zurück! Ist er neugierig? Ich glaube nicht und will auch nicht solchen kindischen Mystifizierungen verfallen. Wir sind ihm wahrscheinlich eher gleichgültig, und das freut mich: Diese noch nie dagewesene, so lange erträumte Begegnung, dieser Moment Natur, der sich mir endlich darbietet, ich möchte ihn genießen, „als wäre ich nicht da“ − unberührt, wild, natürlich.




Es gibt mehr Menschen, die auf dem Mond landeten, ALS LEUTE, DIE MIT EINEM COELACANTHUS SCHWAMMEN.
Entgegen jeder Erwartung kommt er aus seiner Höhle heraus und gleitet der Wand entlang in die Höhe. Wir folgen ihm. Für langsame Verschiebungen benutzt er offenbar nur die Schwanz- und die zweite Rückenflosse, die wie Zeitlupen-Propeller zu rotieren scheinen. Der Fisch ist riesig, geschätzte 2 Meter lang. Deutlich sehe ich die kurzen, weißen Stacheln der Strahlen seiner blauen Rückenflossen. Bei jeder Bewegung seines Körpers läuft eine Art Schauer über seine enormen, ursprünglichen Schuppen, die ebenfalls mit winzigen Dornen versehen sind. Gut zu erkennen sind auch die Knochenplatten seines Schädels, das Atemloch am Ende seiner großen Kiemendeckel, die kleinen kegeligen Zähne auf seinen fl eischigen Kiefern, die tiefen Löcher seines Sensoriums für die elektrischen Felder auf der Nase ... Meine Freude ist schwer zu beschreiben, sie ist groß, aber verinnerlicht. Eine süchtig machende Mischung, die Erfahrung der Schönheit und der Rausch des Privilegs. Doch da ist mehr als das: Genau in diesem Augenblick werden all meine Hoff nungen, meine Hartnäckigkeit in den letzten vier Jahren, meine entschieden verteidigten Überzeugungen, meine sorgfältig verborgenen Zweifel bei dieser einzigartigen Begegnung wieder lebendig. Wir schwimmen Seite an Seite mit diesem urtümlichen Fisch, der als möglicher Vorfahr der Landwirbeltiere gilt, und zwar als erste Menschen überhaupt. Es gibt mehr Personen, die auf dem Mond landeten als mit einem Coelacanthus schwammen.
Der Augenblick ist so überwältigend, dass man sich zusammennehmen muss, um die Arbeit als Naturforscher fortzusetzen. Ein schmerzliches Dilemma: Ich möchte bewundern, muss aber beobachten und darf keine Zeit verlieren. Bereits sind 34 Minuten verstrichen, bis der Quastenflosser endlich den Rand des Grabens erreicht hat und im Dunkel unter meinen Flossen verschwindet. „Könnten wir ihm nicht folgen …?“ Ich bin sicher, dass wir alle diese verführerische, aber selbstmörderische Idee hatten.
Denn für uns wird es Zeit, die Rechnung für dieses Privileg zu begleichen. Ein Blick auf meine Konsole zeigt: 235 Minuten obligatorische Dekompression bleiben bis zum Auftauchen. Wenn ich die bisherige Tauchzeit und allfällige Überraschungen beim Aufstieg dazurechne, wird der Tauchgang fünf Stunden gedauert haben. Der langsame Aufstieg beginnt. Die Dekompressionsstufen dauern immer länger, je mehr man sich der Oberfläche nähert. Die Hälfte des Tauchgangs werden wir schließlich in den letzten 12 Metern verbringen.

Wir kommen eben aus dem Wasser, doch das ENTSCHEIDENDE ERLEBNIS fand VOR ÜBER VIER STUNDEN STATT.
Seit kurzem ist auch ein sehr aggressiver junger Weißspitzen-Hochseehai aufgekreuzt, der unserem übermütigen Gelächter ein Ende setzt. Er ist jung, keine 2 Meter lang, ungestüm und vermutlich enerviert durch die beiden riesigen Angelhaken, die sich in seinen Kiefer gebohrt haben und einige Meter Nylon mitschleppen, die seine Flossen verletzen. Jeden Tag belästigt er uns vom Beginn des Aufsteigens an und bis auf 15 Meter hinauf. Das bedeutet, dass man ihn gute anderthalb Stunden im Auge behalten muss. Dreimal schon musste ich seine Avancen zurückweisen und ihm eins auf die Nase geben ... Soweit ich mich erinnern kann, ist es das erste Mal, dass sich mir ein Hai bis auf Armlänge näherte, ohne dass er durch etwas Fressbares stimuliert worden wäre. Erstaunlich! Aber wenigstens langweilen wir uns nicht, zumal wir ja auch ständig kontrollieren müssen, ob unsere Tauchgeräte in dieser physiologisch kritischen Phase der Dekompression einwandfrei funktionieren. Ständig ist darauf zu achten, dass unser Gasgemisch sich so umwandelt, wie es muss: Schrittweise wird das Helium durch Sauerstoffersetzt, bis es dann in etwa 6 Meter Tiefe, wo wir die letzten zwei Stunden verbringen, aus reinem Sauerstoff besteht.
Die letzte Stunde ist häufig unangenehm. Das Gewicht der Tauchgeräte wird immer stärker spürbar. Der Seegang schüttelt uns genug durch, dass jeder beim Auftauchen über Rückenschmerzen klagt. Die fünf letzten Minuten sind gekommen. Jeder dreht noch eine letzte Rolle und taucht auf. Das Boot ist da, es ist mit uns von der Strömung abgetrieben worden. An Bord können wir uns endlich ohne Tauchmaske und Mundstück anblicken: Die Gesichter wirken müde, aber zufrieden. Erschöpft und froh zugleich, dass die Anspannung zu Ende ist. Nach mehr als vier Stunden kann jetzt jeder erzählen, wie er den Tauchgang erlebt hat. Das tönt bei jedem etwas anders, ein Beweis dafür, dass die große Tiefe unsere Sinne ein wenig verändert. Ein merkwürdiges Gefühl: Man kommt eben aus dem Wasser, doch das entscheidende Erlebnis liegt schon mehr als vier Stunden zurück. „Es war genial, ist aber längst vorbei …“ Schon fast aus der Erinnerung gelöscht. Ein Beweis mehr, dass wir von einem anderen Planeten zurückkehren …

160 MINUTEN in der Nähe des Quastenflossers für insgesamt 185 Stunden Tauchgang! Das ist lächerlich wenig und zugleich MEHR, ALS ICH JE ERWARTETE.
Die Spannung hat nachgelassen, aber das Tagewerk ist noch nicht zu Ende. Zurück an den Strand, Ausladen des Materials, Beladen des Pick-ups, das Schlauchboot anhängen und so weiter … alles wie am Vortag. Im Camp bereiten wir uns schon auf den nächsten Tag vor. Vierzig solche Tage folgen sich. Für mich ist es ein Erfolg, die Krönung einer Etappe und in jedem Fall ein großer Augenblick in meinem Leben.
Die vorstehenden Zeilen sind die eines ideal verlaufenen Tages, bei dem alles rund lief und der Coelacanthus zur Stelle war. Das war jedoch beileibe nicht immer der Fall. Meist zeigte er sich nicht, gelegentlich kam es zu Zwischenfällen: zu wenig Gasgemisch, Unwohlsein beim Tauchen, Probleme mit dem Material oder der Kamera, kurz, nicht richtig geglückte oder völlig missratene Tauchgänge. An solchen Tagen war es schwierig, begeistert zu bleiben, wenn die vielen Stunden der Vorbereitung nicht genügten, um die paar Dutzend Minuten am Meeresgrund zu sublimieren. „All das für das?!“ Der Gedanke lauerte fast jeden Abend im Hinterkopf. Doch das Tieft auchen ist eben so, manchmal unvergesslich, häufig jedoch undankbar. Wenn ich das Logbuch meines Tauchcomputers konsultiere, zeigt sich, dass ich bei all diesen Tauchgängen insgesamt genau 160 Minuten an der Seite des Gombessa verbracht habe. 160 Minuten mit dem wohl ältesten Fisch der Welt zu schwimmen, einem Wesen, das die Wissenschaft bis 1938 als längst ausgestorben betrachtete. 160 Minuten in seiner Nähe für insgesamt 185 Stunden Tauchgang! Das ist lächerlich wenig und zugleich mehr als erwartet.
Während dreißig Tagen im Jahr 2010 und vierzig Tagen jetzt, 2013, haben wir viel über den Coelacanthus gelernt, aber jede Entdeckung warf neue Fragen auf. Doch was wissen wir denn eigentlich über ihn? Fast nichts, außer dass er existiert!
Im Verlauf der jüngsten Expedition haben wir eine ganze Reihe wissenschaft licher Protokolle erstellt, die angesichts der großen Tiefe komplex und kühn waren. Die Ergebnisse werden nun noch aufgearbeitet, und wir sind höchst ungeduldig, etwas mehr über diesen legendärsten Fisch der Welt zu erfahren. Ich verspreche Ihnen, dass wir die Ergebnisse schon sehr bald mit möglichst vielen teilen werden!
www.andromede-ocean.com
www.coelacanthe-projet-gombessa.com
Andere Ausgaben
Verpassen Sie nicht die neueste Ausgabe
Registrieren Sie sich und erhalten Sie neue Veröffentlichungen